Synodalität, aber wie?
Im Zentrum der ersten Thurgauer Pastoralkonferenz in diesem Jahr in Frauenfeld stand die Synodalität. Diesen Weg zu gehen, stand und steht ausser Frage. Anregungen zur Auseinandersetzung, wie der Weg gepflastert werden könnte, gab ein Referat des emeritierten Prof. Dr. Markus Ries. Vor seinen Ausführungen wurden die Co-Präsidentin der Pastoralkonferenz, Karin Flury, und der Stellenleiter Fachstelle Kommunikation, Manuel Bilgeri, verabschiedet.
Papst Franziskus spricht von ihr und der Basler Bischof Felix Gmür erklärt sie zur DNA der Kirche : die Synodalität. Schwieriger wird es, wenn man sie definieren muss. Eine Definition heisst, « als Volk Gottes gemeinsam unterwegs sein » und trifft es relativ gut. Angesichts der anstehenden Probleme in der Kirche – vom Fachkräftemangel über steigende Kirchenaustritte bis zu einer allgemeinen Säkularisierung der Gesellschaft – erlebt der Begriff eine geradezu inflationäre Verwendung. In Wahrheit ist man dabei, ihn zu definieren. Um dabei zu helfen, lieferte Markus Ries in seinem Referat einen breiten geschichtlichen Hintergrund in vier Schritten.
Historischer Rückblick
Ausgehend vom ersten Konzil von Nicäa, welches sich dieses Jahr zum 1700. Mal jährt, erklärte er die Wahlmöglichkeiten von damals. Aus diesen liesse sich eine Art demokratischer Teilnahme herauslesen. Allerdings gab es damals noch keine Gleichberechtigung unter den Menschen, und einzelne Stimmen wurden verschieden gewichtet. Ries erläuterte dies an unterhaltsamen Beispielen wie dem Freisinger Ereignis 1695, wo letztlich nicht derjenige mit den meisten Stimmen zum Bischof gewählt wurde, sondern der mit den gewichtigsten. Dies entsprach der damaligen Vorstellung einer demokratischen Wahl. Erst nach der Aufklärung im 18. Jahrhundert änderte sich das.
Anschein von Demokratie
Allerdings reicht das Zählen von Stimmen allein nicht, führte Ries weiter aus. Beispielsweise ist die Wahl des Papstes bis heute 120 Kardinälen vorbehalten, « und am Schluss werden die Wahlzettel auch noch verbrannt », sagte er. « Etwas Undemokratischeres gibt es eigentlich nicht. » Im weiteren Verlauf der Geschichte mutierten die Synoden zu « Vollzugsgremien », wie ein Beispiel aus den 1959er-Jahren belegt. Nach weiteren Überlegungen zum Thema stellte Ries vier Thesen auf. Zentral dabei war die Erkenntnis, « dass Synode und Demokratie von den Ursprüngen her verschieden sind ». Vor dem Hintergrund der vor fünf Jahren angestossenen modernen Synode, die auf Partizipation beruht, entliess Ries die rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Arbeitsgruppen. Angeregt setzten sich diese mit Zukunftsfragen und der Mitbestimmung in der katholischen Kirche auseinander.
Ralph Weibel, forumKirche, 25.2.25






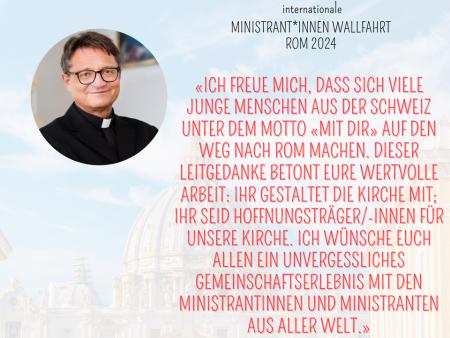

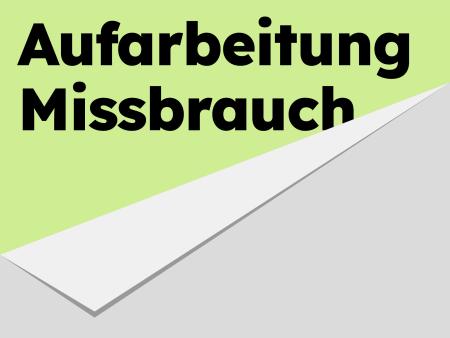


Kommentare